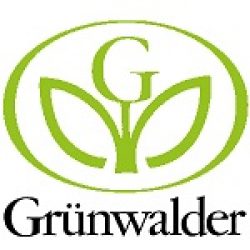Spargel – Entwässern mit köstlichem Gemüse
von Christina Paulson, Aachen
Jetzt ist Spargelzeit. Die leckeren und gesunden Sprossen sprießen aus den sandigen Böden. Ob weiß oder grün: Viele lieben beide Sorten. Überlieferungen zufolge sollen im alten Ägypten die hellen Stangen als „Götterspeise“ den Pharaonen vorbehalten gewesen sein. Die älteste in Europa bekannte schriftliche Erwähnung des Spargels stammt von Hippokrates (460 bis 370 v. Chr.). Der berühmte Grieche betont überraschenderweise die stopfende Wirkung – wahrscheinlich der Wurzel. Auch die harntreibende Wirkung des Spargels war dem griechischen Arzt bekannt. Im östlichen Mittelmeergebiet ist der dünnstängelige Dornenspargel (Asparagus acutifolius) heimisch. Er wächst dort wild auf steinigen warmen, schwach feuchten Böden. Dornenspargel schmeckt leicht bitter und kräftiger als der in Europa eher bekannte Kulturspargel Asparagus officinalis. Der Gattungsname Asparagus stammt aus dem Griechischen und bedeutet „junger Trieb“.
Wohlhabende Römer schätzten die Spargelstangen bereits im 2. Jahrhundert vor Christus. Sie waren Delikatesse und Aphrodisiakum zugleich. Aus dieser Zeit stammt die erste schriftliche Anleitung für den Spargelanbau: Marcus Porcius Cato (234 bis 149 v. Chr.) beschrieb sie in seinem Werk „De Agricultura“. Im 1. Jahrhundert nach Christus pries der römische Militärarzt Dioskurides in seinem Buch „De materia medica“ den Spargel als Heilmittel bei Erkrankungen der Harnwege, der Milz und der Leber. Frauen riet er zum Schutz vor Schwangerschaft, ein Spargel-Amulett zu tragen.
Wer den Spargel über die Alpen nach Mitteleuropa brachte – die Römer, Benediktinermönche oder zurückkehrende Kreuzfahrer –, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. In jedem Fall galt er ab dem Spätmittelalter auch in Deutschland als Heilpflanze; die Mönche hegten und pflegten ihn in ihren Klostergärten.
In der „Leipziger Drogenkunde“ aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind die Spargelsprossen und Samen als Arzneimittel „gegen die Verstopfung der Milz und der Leber, gegen Harnzwang und Harnverhalten sowie gegen Magen- und Darmschmerzen“ erwähnt. Ende des 18. Jahrhunderts galten die Sprossen als Mittel zur „Blutreinigung“ und Hilfe bei rheumatischen Beschwerden. Allerdings dürfte diese Arznei nur für Wohlhabende erschwinglich gewesen sein. Als wirksame Dosis galt ein Pfund Spargelgemüse täglich, und Spargel war auch damals schon teuer. Als Nahrungsmittel spielte er wegen seines geringen Kaloriengehalts für die körperlich schwer arbeitenden Menschen keine Rolle.
Erste Hinweise auf großflächige Spargelkulturen in Deutschland zunächst wohl nur an den Fürstenhöfen Deutschlands, Englands und Frankreichs großer Beliebtheit. Sicherlich auch gefördert durch die aphrodisierende Wirkung, die man ihm nachsagte. So gab der deutsche Arzt und Botaniker Jakobus Theodorus Tabernaemontanus (1520 bis 1590) in seinem 1588 erschienenen Kräuterbuch folgenden Ratschlag: „Nimb Spargenwurtzel und Pfefferkümmel, jedes gleich viel. Stoß diese beyde zu einem subtielen Pulver, und gibt darvon eins quintleins schwer mit fürnem wein zu trincken, es hilfft bald. Gemeldte Arzeney fürdert auch die ehelichen Werck“.
Der Anbau macht den Unterschied

Den Zeichnungen und Gemälden zu Beginn des 17. Jahrhunderts zufolge bauten die Gärtner und Bauern zu jener Zeit vornehmlich Grünspargel an. Die Farbe der Spargelstangen ist allerdings kein Sortenmerkmal, sondern hängt von der Art des Anbaus ab: Solange die fingerdicken Spargelsprosse unterirdisch wachsen, sind sie weiß. Die hellen Stangen müssen die Spargelbauern stechen, bevor der Trieb die Erdoberfläche durchbricht. Den richtigen Zeitpunkt erkennen sie daran, dass sich in den glatt gestrichenen und fest angedrückten Sandwällen feine Risse zeigen. Die Spargelspitzen sind wegen der enthaltenen Anthozyane oft violett gefärbt. Sobald der Spargel aus der Erde wächst, bildet sich Chlorophyll und die Stangen färben sich grün. Spargel, der grün geerntet werden soll, kann daher in flachen Beeten angebaut werden. In der Kultur braucht der Spargel leichte, gering humose, durchlässige Sandböden.
Der grüne Spargel ist nähr- und mineralstoffreicher und schmeckt intensiver als der weiße. Er enthält vor allem Magnesium, Kalium, Vitamin C und Folsäure. Wegen seines geringen Kaloriengehalts und des hohen Anteils an faserigen Ballaststoffen und Wasser (94 Prozent) schätzen ihn figur- und gesundheitsbewusste Menschen. Auch für Diabetiker ist er ein ideales Gemüse.
Einige Nährwerte des rohen, weißen geschälten Spargels:
- Gehalt in 100 g
- Energie: 17 kcal/71 kJ
- Wasser: 94 g
- Kohlenhydrate: 1,9 g
- Eiweiß: 1,9 g
- Fett: 0,1 g
- Ballaststoffe: 1,8 g
- Vitamin C: 21,0 mg
- Folsäure: 0,1 mg
- Kalium: 207 mg
- Magnesium: 20 mg
Harntreibende Saponine
Für die harntreibende Wirkung des Spargels sind die im holzigen Wurzelstock enthaltenen Saponine und die Kaliumsalze verantwortlich. Daher ist die im Herbst ausgegrabene, getrocknete und zerkleinerte Wurzel (Asparagi radix, Asparagerhizoma) Bestandteil entwässernder Tees und einiger Fertigarzneimittel (zum Beispiel Asparagus-P®). Ärzte verordnen sie zur Durchspülungstherapie bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege, bei Reizblase und zur Vorbeugung gegen Nierengrieß. Die Tagesdosis beträgt 45 bis 60 g getrocknete Droge. Da diese Menge mit einem Teeaufguss kaum zu erreichen ist, wird die Spargelwurzel mit stärker entwässernden Drogen wie Brennnessel- oder Petersilienwurzel gemischt. Außerdem sollten Patienten mit einer Harnwegsinfektion zusätzlich zwei bis drei Liter Wasser pro Tag trinken.
Nichts für Gichtkranke
Die im Spargel enthaltenen Saponine können die Nieren reizen. Patienten mit entzündlichen Nierenerkrankungen oder Ödemen als Folge einer Herz- oder Niereninsuffizienz sollten keine Spargelpräparate einnehmen. Chronisch Nierenkranke sollten daher Spargel nur mit Vorsicht genießen. Dies gilt ebenso für Menschen mit erhöhten Harnsäurewerten, besonders Gichtkranke. Spargel enthält etwa 25 mg Purine in 100 g, die im Körper zu Harnsäure abgebaut werden.
Verantwortlich für den typischen milden Spargelgeschmack ist unter anderem das Vanillin. Den eher unangenehmen Geruch des Urins nach Spargelgenuss verursacht die flüchtige Schwefelverbindung Methylmercaptan, ein Abbauprodukt der schwefelhaltigen Asparagussäure.
Die Spargelsaison endet am Johannistag, dem 24. Juni. Dann heißt es im Volksmund: „Kirschen rot, Spargel tot.“ Nach diesem Datum lassen die Spargelbauern die Sprosse zu meterhohen Trieben auswachsen. Sie entwickeln sich bäumchenartig mit vielen feinen dünnen Zweigen. Die oberirdischen Pflanzenteile sorgen dafür, dass das Rhizom Reservestoffe speichern und im folgenden Jahr neue Sprosse treiben kann.
Die kleinen Blüten erscheinen im Juli. Sie sind eingeschlechtlich, bis 7 mm lang, glöckchen-förmig und grün-weiß. Aus den weiblichen Blüten entwickeln sich im August ziegelrote Beeren, die wenig giftige Steroidsaponine enthalten. Erst der Verzehr größerer Mengen führt zu Erbrechen und Bauchschmerzen. Empfindliche Menschen reagieren bei Hautkontakt, zum Beispiel beim Spargelschälen, allergisch. Verursacher sind die schwefelhaltigen Verbindungen der Spargelsprossen. Neben der so genannten „Spargelkrätze“ reagieren manche Allergiker vereinzelt auch mit Heuschnupfen oder Asthmaanfällen auf das feine Gemüse.
Adresse der Verfasserin:
Dr. Christina Paulson
Kantstraße 26
52078 Aachen